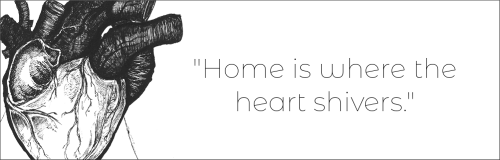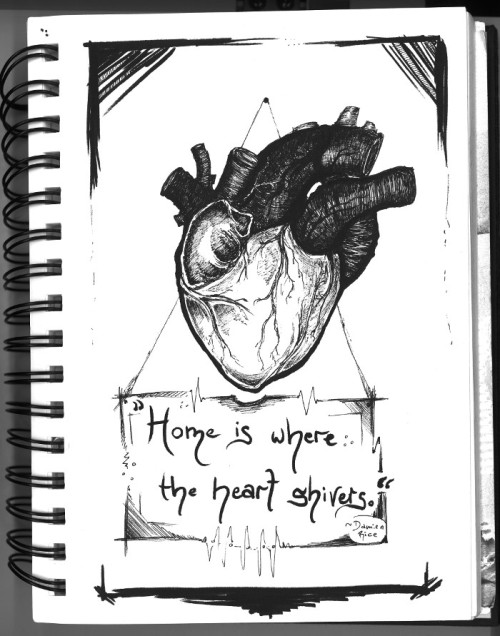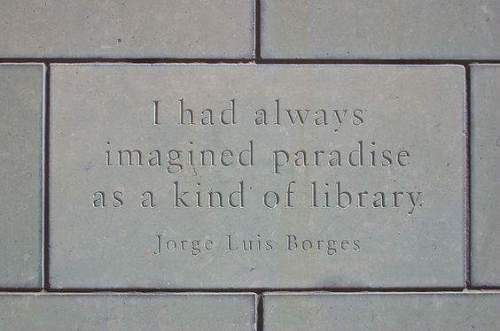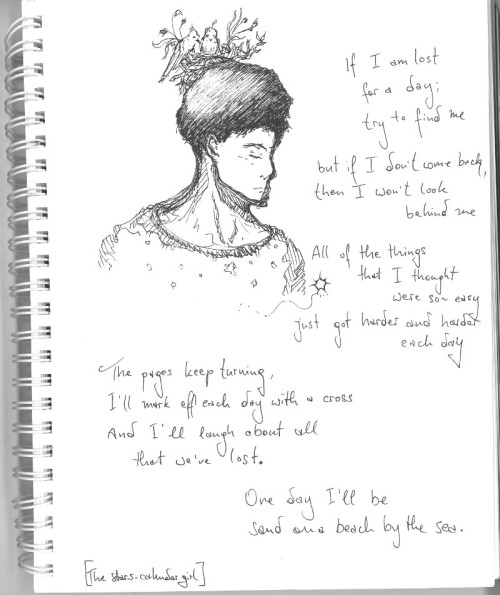If You Were Me

Die Luft ist rein, das Haus ein Museum moderner Kunst. Ganz von selbst setzt man die Schritte vorsichtiger, wenn man das Anwesen betritt, und auch die Schwalben, die sich durch die ebenerdige Lage und die beiden zum Lüften geöffneten Tore ins Haus verirrt haben, schwirren zwar panisch, streifen aber nicht das Geringste mit ihren dünnen Flügeln, ehe sie fast von selbst den Ausgang finden. Ich habe keinen Anfang hier, ich könnte überall den Finger draufsetzen und lossprudeln mit Worten, Tränen, Lachen, allem Furchtbaren und Schönen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich bin verwirrt. Ich bin in einer völlig neuen Umgebung, übe eine völlig neue Tätigkeit aus, die aus stundenlangem trivialen Scannen von unglaublich interessanten Dingen besteht. Nicht einmal diese Aufgabe an sich hat eine eindeutige Emotion. Manchmal von Müdigkeit durchwachsen, von Langeweile, manchmal erfasst mich rege Begeisterung ob mancher Phrasen, die vor gut hundert Jahren mit Tinte und dem Gedanken an Intimität verfasst wurden; so, so schöne Sätze.
Ich sehe mir meine an, meine Sätze, den Brief – den einzigen, den ich seit Jahren wieder verfasst und auch tatsächlich abgeschickt habe, und auch hier wechselt alles von gnadenloser Reue und Unwiederbringlichkeit zu etwas, das man beinahe Erleichterung nennen kann. Ich fühle mich traurig. Es ist vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorbei ist. Ziemlich ist aber nicht völlig. Und dieses Ziemlich darf ich nicht mehr miteinkalkulieren, da es auf nichts Gutes hinausführt. Trost liegt hier nur in einer persönlichen Endgültigkeit, die ich mir nehmen muss. Gleich. Bald. Nur noch ein bisschen verweilen …
Words mean more at night. Es war nicht diese eine Nacht, es hätte in irgendeiner passieren können. Es hätte gar nicht passieren müssen. Ich hätte widersprechen können. Aber auf was hinaus? Dass Timing eine miese, kleine Bitch ist? Dass das Leben gerade zu gut verlief? Und das tat es. In dieser einen Woche war alles, alles gut und so wunderbar, dass ich mich erwischt habe, es zu jinxen. Irgendetwas müsse doch schiefgehen. There you have it.
Aber im Grunde ist das alles ein Jammern auf fürchterlich hohem Niveau. Mir geht es nach wie vor gut, sehr gut sogar, eigentlich, und der aftermath dieser Stunden wird demnächst abfallen, das weiß ich. Gib dem Ganzen eine Woche, vielleicht zwei. Eine Hoffnung weniger, mit jedem Tag, das Sanduhrenprinzip. Zu irgendetwas muss Zeit ja schließlich gut sein.
Die Tage hier fühlen sich an wie Wochen, obwohl kaum etwas passiert. Dadurch werden die kleinen Dinge viel bedeutsamer. Ein viel zu großer Fisch (?) in einem viel zu kleinen Teich, ein winziger, rot umleuchteter Friedhof kurz vor einem Gewitter, und dasselbige, das den ganzen Ort erzittern lässt. Ich finde ein altes NAS auf einem hölzernen Dachboden, setze es mit der Hilfe des Chemikers auf, bin ihm unendlich dankbar und fühle mich dennoch wie Superhacker 2000. Essen liefert ein scheinbar niemals versiegender Quell eines gigantischen Kühlschranks, Zauberhaftes wie ein Rumpsteak mit selbst hergestelltem Rotwein, Hirschpastete (because, what else would you eat?) und dazwischen die kleinen Reibereien mit dem hundertjährigen Toaster, der das Brot nie hergeben will (langsam nehme ich die kleinen Blitze in seinem Inneren persönlich). Der Hausherr scheint ein reger Earl-Grey-Liebhaber zu sein, und einmal nehme ich mir eine Tasse davon ins Arbeitszimmer mit und im nächsten Augenblick krabbelt mir eine Wespe über die Hand und beinahe hätte ich das Zeug auf die alten Briefe geschüttet. Der Zucker wird heruntergeschraubt, auch der Kaffee, weil es zwar eine Siebträgermaschine, aber nur Kapseln für die Nespresso-Perversion gibt. Wenn ich aufwache, frühstücke, ins Arbeitszimmer gehe, begleiten mich Gemälde, viele sind von ihr, die sie vor fünf Jahren verstorben ist. Und noch immer redet er von ihr, beginnt sein Buch damit, wie er ihr jeden Tag I love you zurief. Dreiunddreißig Jahre glückliche Ehe, für ihn ist sie nicht tot, denke ich. Eine kleine Leninstatue aus Bronze hält mir die Tür auf, bei mir wird er brav in die Arbeiterklasse geschickt, wie der Hausherr zu mir meinte. Drüben steht Mao, wenn ich mich richtig erinnere, Stalin fehle ihm noch. Die Fenster im Museumsgang (so nenne zumindest ich den Traktteil mit den vielen Kunstwerken) sind vom Wiener Arsenal, bei ihm wieder flottgemacht und eingebaut. Alles hat etwas Rustikales und auf den ersten Blick erkennt man den Adel nicht, das mag ich. Überall starren mir Gesichter aus Rahmen entgegen, stehen Bronze-Golems, hängen gigantische, menschgemachte Glaslaternen. Hier, mit all diesen Kuriositäten, fühle ich mich immer weniger als Fremdkörper und immer mehr als Inkorporation. Eine Art Zaungast, den sich das Haus nach und nach einverleibt; der neue Archivar, der hier nun ein- und ausgeht. Wie wird es wohl, wieder zurückzukommen? Und wohin gehe ich dann? Woher man so kommt und geht .. my, der Brief; war der vielleicht mies formuliert …
Die nächsten Tage und Wochen und fast schon Monate sind plötzlich durchgeplant. Zwei Ausstellungen, die aus dem Nichts kamen und mich unendlich freuen, die Teilnahme an einer Universitätskonferenz, die Tage im Archiv, die reguläre Arbeit in den unheiligen Messehallen, das Unisemester und die bevorstehende Masterarbeit, die beinahe wieder auf Ground Zero gekickt wurde, und zuguterletzt die Resteinrichtung der Wohnung. Und wenn ich im September endlich im Flieger Richtung Vietnam sitze, spätestens dann ist die Welt wieder verflucht okay. Vermutlich bereits viel, viel früher. Vermutlich schon jetzt. There you go, Sanduhr, there you go.